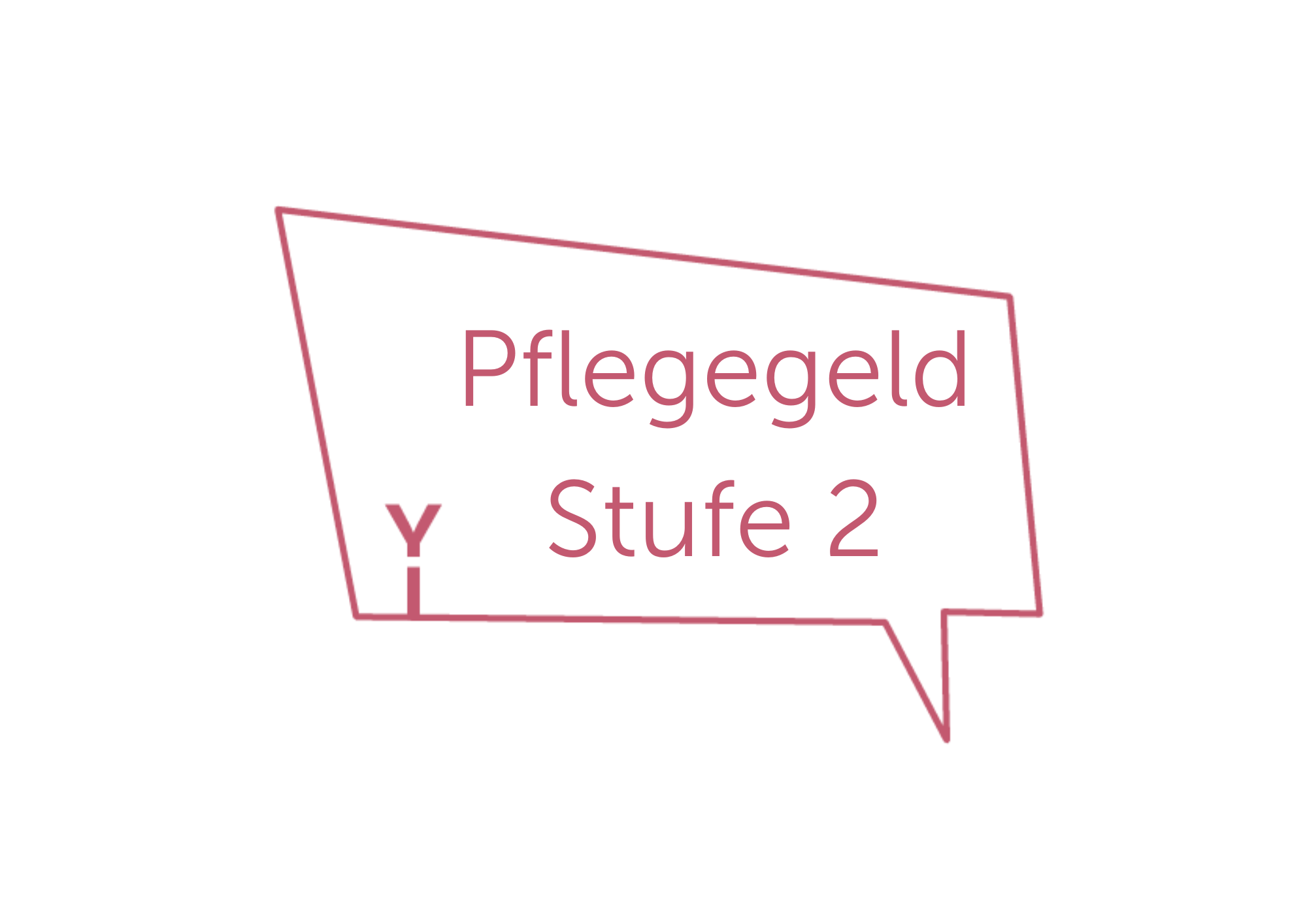Pflegebedürftigkeit ist ein Thema, das viele Menschen in Österreich direkt oder indirekt betrifft, sei es durch eigene Erfahrungen oder durch die Betreuung nahestehender Personen. Im Zuge dessen spielen die sogenannten Pflegestufen eine zentrale Rolle. Sie dienen als Orientierungspunkt für die Schwere der Pflegebedürftigkeit und legen fest, welcher Unterstützungsbedarf besteht.
Eine professionelle Pflegegeldberatung kann dabei helfen, die passenden Leistungen in der jeweiligen Pflegestufe zu identifizieren. Das HeldYn Netzwerk von ausgebildeten Dimplomkrankenpfleger:innen bietet Ihnen die nötige Pflegegeldberatung und Unterstützung. In diesem Artikel fokussieren wir uns auf die Pflegestufe 2, um ein tieferes Verständnis für ihre Kriterien, Leistungen und Besonderheiten zu bieten.
Was bedeutet Pflegestufe 2?
Um in die Pflegestufe 2 eingestuft zu werden, muss der pflegebedürftige Mensch einen Pflegebedarf von mehr als 95 Stunden pro Monat, aber weniger als 120 Stunden pro Monat aufweisen. Dieser Zeitrahmen kann variieren, je nach individueller Situation und Art der erforderlichen Pflege.
Kriterien zur Einstufung
- Grundpflege: Dazu gehören Aktivitäten wie Anziehen, Waschen und Ernährung.
- Hauswirtschaftliche Versorgung: Dies umfasst Tätigkeiten wie Kochen, Reinigen und Einkaufen.
- Mobilisierung: Unterstützung bei Bewegungen, etwa Aufstehen, Gehen oder Positionieren.
Vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, „Pflegegeld“, sozialministerium.at, 01.01.2025, https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege/Pflegegeld.html, 09.01.2025.

Voraussetzungen und Bedingungen für Pflegestufe 2
Für die Zuordnung zur Pflegestufe 2 sind neben dem reinen Zeitaufwand auch andere Faktoren maßgeblich:
- Medizinischer Befund: Dieser gibt Aufschluss über die Art und Schwere der Erkrankung oder Beeinträchtigung.
- Selbstständigkeit: Hier wird bewertet, inwiefern die betroffene Person noch in der Lage ist, alltägliche Aufgaben ohne Hilfe zu bewältigen.
- Soziale Umgebung: Auch die familiäre und soziale Situation spielt eine Rolle bei der Beurteilung.
Zur Einstufung in eine Pflegestufe ist in der Regel ein Gutachten erforderlich. Dieses wird von speziell geschulten Expert:innen erstellt, die sowohl die medizinische als auch die soziale Situation des Betroffenen berücksichtigen.
Unterschiede zu anderen Pflegestufen
Jede Stufe hat ihre eigenen Kriterien und ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Um die Besonderheiten der Pflegestufe 2 besser zu verstehen, ist es hilfreich, sie im Kontext der anderen Pflegestufen zu betrachten.
Pflegestufe 1 vs. Pflegestufe 2
Pflegestufe 1 bezeichnet in der Regel einen geringeren Pflegebedarf im Vergleich zur Pflegestufe 2:
- Zeitaufwand: Bei Stufe 1 liegt der wöchentliche Pflegeaufwand meist unter 95 Stunden pro Monat, aber bei mehr als 65 Stunden.
- Selbstständigkeit: Personen in Pflegestufe 1 können oft noch viele alltägliche Tätigkeiten allein ausführen und benötigen in erster Linie Unterstützung bei spezifischen Aufgaben.
Im Gegensatz dazu weist Pflegestufe 2 auf einen höheren Pflegebedarf hin, der durch einen erhöhten Zeitaufwand und eine größere Abhängigkeit von Hilfe in verschiedenen Lebensbereichen gekennzeichnet ist.

Vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, „Pflegegeld“, sozialministerium.at, 01.01.2025, https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege/Pflegegeld.html, 09.01.2025.
Pflegestufe 2 vs. Pflegestufe 3
Während die Pflegestufe 2 einen moderaten Pflegebedarf darstellt:
- Zeitaufwand: Bei Stufe 3 liegt der wöchentliche Pflegeaufwand bei über 120 Stunden pro Monat.
- Pflegeintensität: In der Pflegestufe 3 sind die Anforderungen an die Pflege häufig intensiver, beispielsweise durch schwerwiegendere gesundheitliche Einschränkungen oder eine größere Abhängigkeit in der Bewältigung des Alltags.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pflegestufe 2 eine mittlere Position im System der Pflegestufen einnimmt. Sie ist gekennzeichnet durch einen erheblichen, aber nicht extremen Pflegebedarf und erfordert eine entsprechende Unterstützung und Betreuung. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu kennen, um entsprechende Ressourcen und Unterstützungen gezielt zu nutzen.
Vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, „Pflegegeld“, sozialministerium.at, 01.01.2025, https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege/Pflegegeld.html, 09.01.2025.
Leistungen und Unterstützungen bei Pflegestufe 2
Für Personen, die in die Pflegestufe 2 eingestuft werden, gibt es in Österreich eine Reihe von Leistungen und Unterstützungsangeboten. Diese sollen sicherstellen, dass der individuelle Pflegebedarf gedeckt ist und Betroffene eine angemessene Betreuung und Versorgung erhalten.
Monatliche Geldleistungen
Bei der Pflegestufe 2 haben Betroffene Anspruch auf eine monatliche finanzielle Unterstützung von 370,30 €, um die Kosten für die Pflege und Betreuung zu decken. Dieser Betrag ist dazu gedacht, die finanzielle Belastung für Pflegebedürftige und ihre Familien zu reduzieren und kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, sei es für die Bezahlung eines Pflegedienstes, die Anschaffung von Pflegehilfsmitteln oder für sonstige pflegebedingte Ausgaben.

Vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, „Pflegegeld“, sozialministerium.at, 01.01.2025, https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege/Pflegegeld.html, 09.01.2025.
Sachleistungen und Dienste
Neben den Geldleistungen gibt es eine Reihe von Sachleistungen und Diensten, auf die Personen mit Pflegestufe 2 Anspruch haben können:
- Ambulante Pflegedienste: Professionelle Pflegekräfte, die zu den Betroffenen nach Hause kommen, um bei der Pflege und Betreuung zu helfen.
- Tages- und Nachtpflege: Angebote, bei denen Pflegebedürftige tagsüber oder nachts in einer Einrichtung betreut werden, während sie weiterhin in ihrem Zuhause leben.
- Pflegehilfsmittel: Unterstützende Geräte und Hilfsmittel, wie z.B. Gehhilfen, Badehilfen oder spezielle Betten, die den Alltag erleichtern.
- Beratungsdienste: Beratungsstellen und Informationsangebote, die bei Fragen zur Pflege, zu rechtlichen Themen oder zur Antragstellung helfen.
Zusätzliche Unterstützungsangebote
In manchen Fällen können noch zusätzliche Unterstützungsangebote relevant sein:
- Kurzzeitpflege: Temporäre Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung, z.B. wenn die pflegenden Angehörigen in den Urlaub fahren oder eine Auszeit benötigen.
- Hauswirtschaftliche Unterstützung: Dienste, die bei der Hausarbeit, beim Kochen oder Einkaufen helfen.
- Therapeutische Angebote: Physiotherapie, Ergotherapie oder andere therapeutische Maßnahmen, die zur Erhaltung oder Verbesserung der Mobilität und Lebensqualität beitragen.
Wie kann HeldYn Ihnen helfen?
Buchen Sie jetzt Ihre professionelle Pflegegeldberatung. Wir unterstützen Sie bei allen Fragen rund um das Pflegegeld und helfen Ihnen, Ihre Ansprüche optimal zu nutzen. Unsere qualifizierten Diplomkrankenpfleger:innen, ausgewählt nach Ihren persönlichen Präferenzen, begleiten Sie und Ihre Familie einfühlsam durch den gesamten Prozess des Antrags. Rufen Sie uns einfach unter 0660-7351133 an und sichern Sie sich Ihre individuelle Beratung. Wir sind für Sie da!
Tipps und Empfehlungen
Sollten Sie zum ersten Mal mit der Beantragung einer Pflegestufe konfrontiert sein, macht es Sinn vorab ein Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen. Dies informiert Sie über notwendige Dokumente, den Ablauf der Begutachtung und bietet Raum, um etwaige Unsicherheiten zu klären. So wissen Sie, was auf Sie und Ihre Angehörigen zukommt und können dem Beantragungsprozess so organisiert und vorbereitet wie moglich entgegentreten. HeldYn hilft Ihnen gerne dabei, rufen Sie uns einfach unter 0660-7351133 an!
Der erste Schritt in das Pflegestufensystem fällt vielen Menschen schwer und verlockt zur Aufschiebung. Selbst wenn noch nur ein geringer Pflegebedarf besteht, ist es wesentlich möglichst früh einen Antrag auf Pflegegeld einzureichen. Somit können Sie sich zeitgerecht Unterstützung sichern, sobald sich erste Herausforderungen abzeichnen.
- Dokumentation: Eine gründliche Dokumentation des Hilfebedarfs durch Ärzt:innen oder Therapeut:innen kann ein entscheidender Faktor sein. Sein Sie somit bei der Dokumentation so präzise wie möglich.
- Vollständigkeit: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Fragen im Antragsformular beantwortet und alle benötigten Unterlagen beigelegt haben, denn hier liegt der häufigste Fehler. Kontrollieren Sie den Antrag vor dem Absenden lieber zweimal.
- Aktualität: Ältere medizinische Berichte spiegeln möglicherweise nicht den aktuellen Zustand wider. Achten Sie unbedingt darauf, aktuelle Dokumente einzureichen.
- Auf Rückfragen reagieren: Wenn die Behörde Rückfragen hat oder weitere Dokumente anfordert, reagieren Sie so schnell wie möglich. Verzögerungen können den Prozess schnell in die Länge ziehen.
Eine Unterstützung für pflegende Angehörige wird in der Regel erst ab der Pflegestufe 3 gewährleistet. Eine Ausnahme stellt allerdings die Pflege eines/einer nahen Angehörigen mit demenzieller Erkrankung (oder einer minderjährigen Person) dar. Hier kann eine Förderung bereits ab Pflegestufe 1 beantragt werden, sobald die Pflege (mindestens) über den Verlauf eines Jahres erfolgte.
Vgl. „Pflegende Angehörige”, pv.at, 18.02.2020, https://www.pv.at/cdscontent/?contentid=10007.707703&portal-pvaportal, 17.05.2024.
EUm den Alltag zu erleichtern und eine möglichst reibungslose Pflege zu gewährleisten empfiehlt es sich ein Pflegekonzept zu erstellen. In diesem individuellen Pflegeplan werden die Wünsche und Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person berücksichtigt und ihr Pflegebedarf verzeichnet. So entsteht Klarheit für alle Personen, die an der Pflege der/des Betroffenen teilhaben
Pflegebedürftigkeit bedeutet in der Regel eine Einschränkung der Mobilität der Betroffenen. Insofern ist es hilfreich die Wohnung der pflegebedürftigen Person moglichst barrierefrei zu gestalten. Damit konnen Sie das Risiko von Stürzen und Verletzungen minimieren und gleichzeitig die Selbstständigkeit der betroffenen Person unterstutzen.